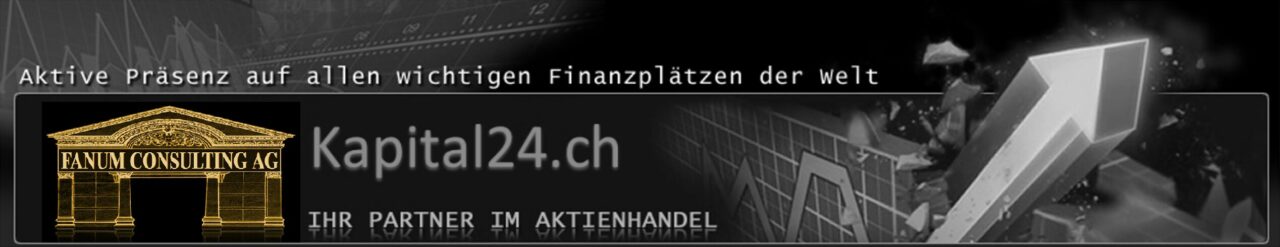Der Flugzeugbauer Airbus will es wissen und eröffnete auf der anderen Seite des Atlantiks sein erstes Werk in Alabama, USA. Damit soll auf den grossen Konkurrenten Boeing mehr Druck ausgeübt werden. Der Wettkampf in dessen Heimatmarkt hat begonnen!
Airbus-Flugzeuge in den USA
Das erste Werk wurde für die Endmontage der Mittelstrecken-Jets der A-320-Serie konzipiert. Das Unternehmen will damit nicht einfach nur expandieren, sondern direkt vor Ort produzieren können. Das spart Geld ein und erleichtert den Vertrieb, aber vor allem erhoffen sich die Manager mehr US-Marktanteile. “Wir hoffen, dass wir den US-Marktanteil auch mit Hilfe des neuen Werks auf 50 Prozent steigern können”, erklärte Airbus-Chef Fabrice Brégier. In 2012 hatte man bereits 20 Prozent besessen und sich dann für den neuen Standort in Alabama entschieden. Während der Bau begann, kamen neue Aufträge aus den USA hinzu und nun liegt der Marktanteil schon bei 40 Prozent. Das Ziel mit der Hälfte ist also nicht mehr weit entfernt.
Doch hinter dem neuen Werk stecken auch noch ganz andere Pläne: “Wir glauben, dass es strategisch wichtig ist, neben Europa in den zwei Schlüsselmärkten USA und China verwurzelt zu sein”, erklärt Brégier. Den A-320 kann Airbus bisher nur an drei Standorten fertigstellen. (Hamburg, Tianjin, Toulouse)
Frachter liefern Einzelteile
Da aber die einzelnen Bestandteile des Airbus A-320 in Europa gefertigt werden, müssen diese irgendwie nach Europa gelangen. Dafür wählt Airbus den Schiffsweg. In den USA sind Mittelstrecken-Maschinen ein sehr grosser Markt und Airbus will hier nun noch mehr mitverdienen. Es wird auch mit einer erhöhten Nachfrage in den nächsten Jahren gerechnet. Der A-320 deckt diesen Bedarf perfekt ab. Die Aufträge zur Produktion neuer Maschinen sind zahlreich und Airbus benötigt dringend mehr Kapazitäten um diese in angemessener Zeit herstellen zu können.
Doch erst die Teile von Europa über den Atlantik schippern und dann dort noch fertigmontieren lassen, das soll günstiger sein? Wenn es nach dem Airbus-Chef geht ja. In den USA lasse sich effizienter produzieren und die zu zahlenden Löhne fallen geringer aus, was die Transportkosten ausgleicht.