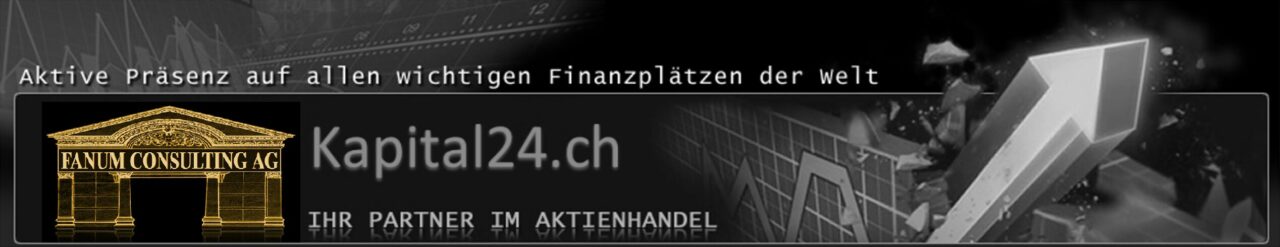US-Präsident Donald Trump hätte sich in diesen Tagen eigentlich mit der chinesischen Regierung austauschen sollen. Es geht darum, ob die im Januar gemachten Zugeständnisse beider Nationen auch wirklich eingehalten wurden. Statt den Handelsstreit einen Schritt in Richtung Ende zu bringen, lehnt Trump ab. Unterdessen zeigen neueste Zahlen aus China, dass die erhobenen Strafzölle ihre Wirkung nicht verfehlen.
Absage auf unbestimmte Zeit
Trump nutzte einen Wahlkampfauftritt in Yuma dafür, eben diese Botschaft zu überbringen. Das im Frühjahr entstandene Teilhandelsabkommen sollte jetzt auf den Prüfstand kommen. Doch der US-Präsident zeigte sich sauer auf das Reich der Mitte. „Ich will jetzt nicht mit ihnen verhandeln“, sagte er und schob den schwarzen Peter namens Corona den Chinesen in die Schuhe.
Dabei wäre es für die weiteren Verhandlungen hochinteressant zu wissen, ob sich beide Wirtschaftsmächte an das Abkommen gehalten haben. So sollte China seine Importe aus den USA drastisch erhöhen. Trump hat seinen Sündenbock gefunden und konzentriert sich vorrangig auf seine Wiederwahl im November. Somit sind die Gespräche mit China erst einmal auf Eis gelegt.
Strafzölle belasten Chinas Konjunktur
Viele Jahre wurde China als Produktionsstandort von zahlreichen Unternehmen und Branchen favorisiert. Vor allem die Elektroniksparte ließ sich von dort günstig beliefern. Dank der Corona-Pandemie und dem Handelsstreit mit den USA, wandelt sich dieser Trend. Zunehmend verlagern Konzerne ihre Produktions- und Lieferketten ins eigene Land oder anderswo hin.
Anders ausgedrückt, wollen international aufgestellte Unternehmen ihre Abhängigkeit von China reduzieren. Somit entgehen sie dem Handelsstreit und allem was da in Zukunft noch kommen könnte. So berichtet es die „Financial Times“, unter Berufung auf eine Studie. Diese wurde von Baker McKenzie und Silk Road Associates erstellt. Demnach sank der Marktanteil am weltweiten Export auf 22 Prozent und betrug somit drei Prozent weniger als im Vorjahr.
Die USA spielt dabei eine zentrale Rolle. Huawei ist ein gutes Beispiel, denn der chinesische Telekommunikationsausstatter hat es hier mit seinem Absatz schwer. Mittlerweile müssen US-Firmen eine Genehmigung beantragen, wenn sie Mikrochips an Huawei und dessen Tochterunternehmen verkaufen wollen. Allerdings nur dann, wenn Software oder Maschinen zur Fertigung genutzt werden, welche aus den USA stammen. Schlimmstenfalls erhält Huawei damit kaum noch Zugang zu führenden Chip-Technologien.