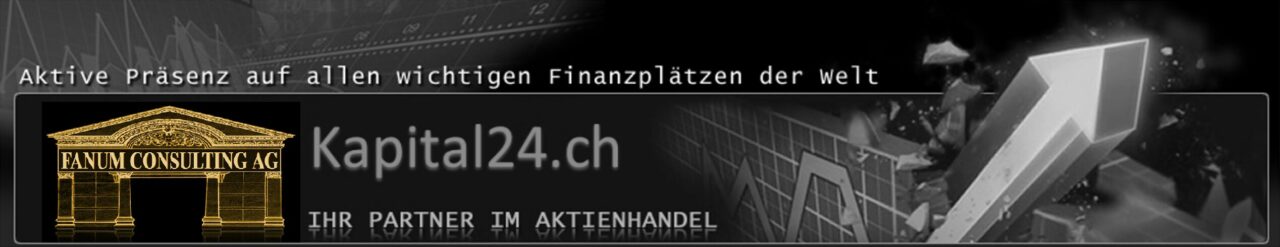Renaissance der Kernkraft – ungelöste Altlasten
Die Kernenergie erlebt international eine Renaissance. Angesichts steigender Stromnachfrage und klimapolitischer Ambitionen setzen immer mehr Länder wieder auf Atomkraftwerke. Doch die Rückkehr dieser Technologie rückt eine bislang ungelöste Problematik erneut in den Vordergrund: den langfristigen Umgang mit hochradioaktivem Abfall. Weltweit lagern hunderttausende Tonnen verbrauchter Brennelemente – ohne finale Entsorgungslösung.
In den USA etwa befinden sich über 90.000 Tonnen abgebrannter Kernbrennstoff in temporären Zwischenlagern. Diese befinden sich auf dem Gelände aktiver oder stillgelegter Kernkraftwerke und bestehen aus Wasserbecken („Spent-Fuel-Pools“) sowie zylindrischen Trockenbehältern. Der politische Widerstand gegen dauerhafte Lagerstätten und die juristische Blockade von Projekten wie dem Yucca-Mountain-Endlager haben dazu geführt, dass es bis heute keine nationale Endlagerlösung gibt.
Geologische Tiefenlager als internationale Lösung
Internationale Fortschritte im Umgang mit radioaktivem Abfall kommen vor allem aus dem Norden Europas. In Finnland entsteht mit dem Projekt Onkalo das weltweit erste geologische Endlager für hochradioaktiven Abfall. Der Ansatz: Die Endlagerung in tiefen Gesteinsschichten soll über hunderttausende Jahre hinweg eine sichere Isolation gewährleisten.
Das KBS-3-Verfahren: Schwedens mehrstufiges Sicherheitskonzept
Ein ähnliches Konzept verfolgt Schweden mit dem sogenannten KBS-3-Verfahren. Dabei wird der abgebrannte Brennstoff zunächst in dickwandige Kupferbehälter eingeschlossen. Diese werden anschließend in rund 500 Meter Tiefe in Granitgestein eingebracht und von einer speziellen Tonschicht aus Bentonit umgeben. Das Verfahren kombiniert technische und natürliche Barrieren, um eine langfristige Isolation der Strahlung zu gewährleisten.
Das Besondere: Selbst unter extremen geologischen Bedingungen – etwa Wasserzutritt oder tektonische Aktivität – soll die Konstruktion über Zehntausende Jahre stabil bleiben. Das KBS-3-Konzept gilt daher als eines der robustesten Endlagermodelle weltweit und dient auch anderen Ländern als Referenz.
Technologische Innovation: Hoffnung durch Transmutation
Neben Endlagerstrategien setzen Forschungseinrichtungen und Industriekonsortien verstärkt auf technologische Lösungen zur Verringerung der Gefährlichkeit des Abfalls. Im Zentrum steht die nukleare Transmutation – ein physikalischer Prozess, bei dem langlebige radioaktive Isotope in kurzlebigere oder stabile Elemente umgewandelt werden.
Durch gezielte Bestrahlung der Abfälle in speziellen Reaktoren oder Teilchenbeschleunigern könnte die Strahlungsintensität signifikant gesenkt und die Lagerdauer von Jahrtausenden auf wenige Jahrhunderte verkürzt werden. Pilotprojekte und Forschungszentren in Europa und Asien untersuchen derzeit die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit dieser Methode. Gelingt der Durchbruch, könnte Transmutation ein entscheidender Baustein für eine nachhaltige Atomwirtschaft werden.
Fazit: Abfallmanagement als Voraussetzung für Atomrenaissance
Die Rückkehr der Kernenergie als Teil des Energiemixes ist ohne eine glaubwürdige Lösung für den radioaktiven Abfall nicht denkbar. Während geologische Tiefenlager in wenigen Ländern als realistische Option vorangetrieben werden, könnten neue Technologien wie die Transmutation künftig dazu beitragen, die Langzeitrisiken weiter zu reduzieren.
Wer Entwicklungen im Energiesektor, insbesondere im Bereich der Kernkraft, aufmerksam verfolgt, erkennt das Potenzial für strukturelle Marktbewegungen – und für neue Investitionschancen.